ab München Hbf 6:52, an Berlin Zoo 14:19
674 km
7:27 Stunden
DM 170.-/85.- zzgl. IC-Zuschlag (DM 6.-)
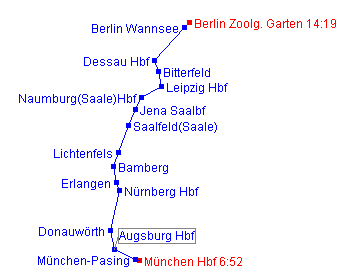
ab München Hbf 7:14, an Göttingen 10:56
ICE 694
ab Göttingen 11:05, an Berlin Zoo 14:01
944 km
6:47 Stunden
DM 250.-/125,-
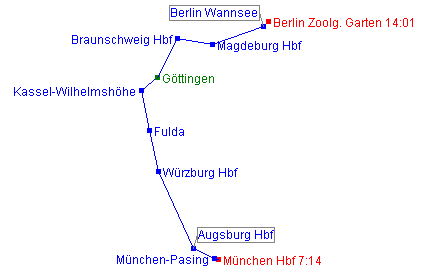
1 Problemdarstellung |
Die üblicherweise in der einschlägigen Literatur beschriebenen Verfahren beruhen jedoch auf einigen Annahmen, die im Hinblick auf öffentliche Verkehrsmittel unzutreffend sind:
So lassen sich PC-Programme zur Wegeplanung in der Regel vom Anwender auf dessen Fahrgewohnheiten einstellen. Es können vor allem für verschiedene Straßenkategorien unterschiedliche Reisegeschwindigkeiten vorgegeben werden. Diese Geschwindigkeitsvorgaben werden dann aber einheitlich für die gesamte Wegesuche zur Reisezeitbewertung der entsprechenden Kanten herangezogen.
Unterschiedliche Durchfahrtsaufwendungen, beispielsweise durch schwankendes Verkehrsaufkommen im Laufe eines Tages, lassen sich durch dynamisch angepaßte Kantenbewertungen berücksichtigen. Dies könnte beispielsweise anhand von Zeitfenstern geschehen: Jede Kante kann in jedem Zeitfenster unterschiedlich bewertet werden. Innerhalb der einzelnen Zeitfenster ist die Bewertung jedoch wieder konstant.
Durch Zeitfenster läßt sich auch die Verfügbarkeit von Kanten zeitlich einschränken. So lassen sich etwa Nachtfahrverbote oder zeitweilige Einbahnregelungen berücksichtigen.
Oftmals sind Aufwendungen innerhalb von Knoten ebenfalls zu betrachten, z.B. für Abbiegevorgänge oder für das Durchqueren großer Kreuzungen. Eine Möglichkeit besteht darin, solche Knoten wiederum als Netz (sprich: als Graph) zu betrachten. Die Modellierung solcher hierarchischer Graphensysteme behandelt u.a. ROSE (1996) B.
Dies gilt auch für andere Bewertungskriterien als dem der Zeit: Unterschiedliche Tarife für unterschiedliche Verkehrsmittelkategorien auf derselben Strecke sind eher der Normalfall als die Ausnahme. Lediglich die räumlichen Entfernungen bleiben konstant. Diese spielen aber bei der Wegewahl allgemein, erst recht aber bei der Wegewahl in öffentlichen Verkehrssystemen, eine eher unbedeutende Rolle.
Im Gegensatz zu individuellen Verkehrsmitteln stehen Kanten nur zu fest vorgegebenen Zeiten in Form von Teilverbindungen zur Verfügung. Dies können entweder unregelmäßige oder vertaktete Zeiten sein. Die Anzahl der Teilverbindungen pro Tag kann hierbei sehr unterschiedlich ausfallen, von einigen wenigen werktäglichen Teilverbindungen auf Regionalstrecken bis zum Zwei-Minuten-Takt während der Stoßzeit im Schnellverkehr von Ballungsräumen.
Aus dieser Tatsache heraus ergibt sich ein weiteres Problem: das der Anschlüsse. Durch die zeitdiskrete Verfügbarkeit aller Kanten ergeben sich bei den Übergängen von einer Kante zur nächsten zwangsläufig Wartezeiten, die in die zeitliche Gesamtbewertung eines Weges einfließen müssen. Sofern in einem Knoten ein echter Umsteigevorgang stattfindet, muß aber auch, je nach räumlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen des Fahrgastes, eine mehr oder minder große Pufferzeit eingehalten werden.
Im Gegensatz zur reinen Wegesuche beim Individualverkehr hat man es beim Fahrplanverkehr meist mit der Suche nach einer bestimmten Verbindung zu tun. Diese bedient sich zwar auch eines Weges, eine Verbindung besteht aber aus ganz bestimmten Teilverbindungen, die auf den Kanten dieses Weges verkehren.
| IC 806
ab München Hbf 6:52, an Berlin Zoo 14:19 674 km
|
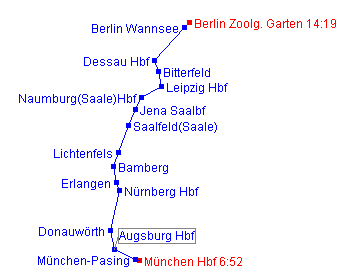 |
| ICE 682
ab München Hbf 7:14, an Göttingen 10:56 ICE 694 ab Göttingen 11:05, an Berlin Zoo 14:01 944 km
|
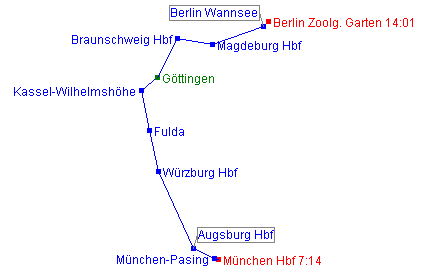 |
Die Preisangaben beziehen sich auf eine einfache Fahrt im Normaltarif
bzw. mit Bahncard (50% Ermäßigung).
Wie deutlich zu erkennen ist, würde eine nur auf Geschwindigkeit
hin optimierte Verbindungssuche in jedem Falle die ICE-Verbindung mit Umsteigen
in Göttingen vorschlagen. Da diese Verbindung sowohl eine spätere
Abfahrts- als auch eine frühere Ankunftszeit hat, spielt es dabei
auch keine Rolle, ob für die Suche die früheste gewünschte
Abfahrtszeit oder aber die späteste gewünschte Ankunftszeit angegeben
wurde.
Diese Verbindung ist zwar um 40 Minuten schneller, dieser Zeitvorteil gegenüber der IC-Direktverbindung wird aber mit einigen Nachteilen erkauft:
Auch in diesem Falle würde bei einer reinen Fahrzeitoptimierung einer bestimmten Verbindung absolut der Vorzug gegeben, nämlich der mit dem EuroCity.
Entfernungsunterschiede gibt es in diesem Fall nicht, da jedesmal dieselben Strecken benutzt werden. Der Fahrzeitunterschied ist mit nur fünf Minuten in der Praxis meist vernachlässigbar. Im Normaltarif ist die ICE-Fahrt um knapp 10% (DM 5.-) teurer, mit Bahncard aber sogar um 30 Pfennig billiger.
Aufgrund dieser geringen Unterschiede könnten andere Gesichtspunkte zur Variantenwahl herangezogen werden. Folgende Gründe könnten die Wahl zugunsten des ICE beeinflussen:
| 08:13
08:27 |
ab Machtlfinger Straße
an Marienplatz |
U-Bahn U3
Richtung Olympiazentrum |
| 08:31
08:37 |
ab Marienplatz
an Ostbahnhof München |
S-Bahn S4
Richtung Ostbahnhof München |
| 08:41
10:28 |
ab Ostbahnhof München
an Salzburg Hauptbahnhof |
RE 3507
Richtung Salzburg Hauptbahnhof |
Bereits die Umsteigezeit von der U3 zur S4 erscheint relativ knapp.
Durch die sehr hohe Zugfolge der S-Bahn auf dem benutzten Streckenabschnitt
fällt dies aber nicht ins Gewicht.
Das eigentliche und besondere Problem dieses Verbindungsvorschlages
liegt in seinem Übergang von den innerstädtischen Verkehrsmitteln
mit seinen hohen Taktfrequenzen (in diesem Fall U- und S-Bahn) zum Regional-
und Fernverkehr der Bahn. Auch wenn auf dem Münchner Ostbahnhof nicht
besonders weit von der S-Bahn zu den Fernverkehrsgleisen ist, erscheinen
vier Minuten Spielraum zum Umsteigen doch sehr knapp. Sollte der RegionalExpress
nach Salzburg verpaßt werden, so bedeutet dies für den Fahrgast
eine Stunde Wartezeit bis zur nächsten Fahrtmöglichkeit.
Angesichts der dichten Zugfolgen bei den Zubringerverkehrsmitteln wird
der Fahrgast in der Praxis wohl einige Taktperioden früher an der
Machtlfinger Straße losfahren. Die eingeplanten Umsteigereserven
wird man also üblicherweise immer dann höher bemessen, wenn im
Falle eines verpaßten Anschlusses eine längere Wartezeit bis
zur darauffolgenden Fahrtmöglichkeit droht.